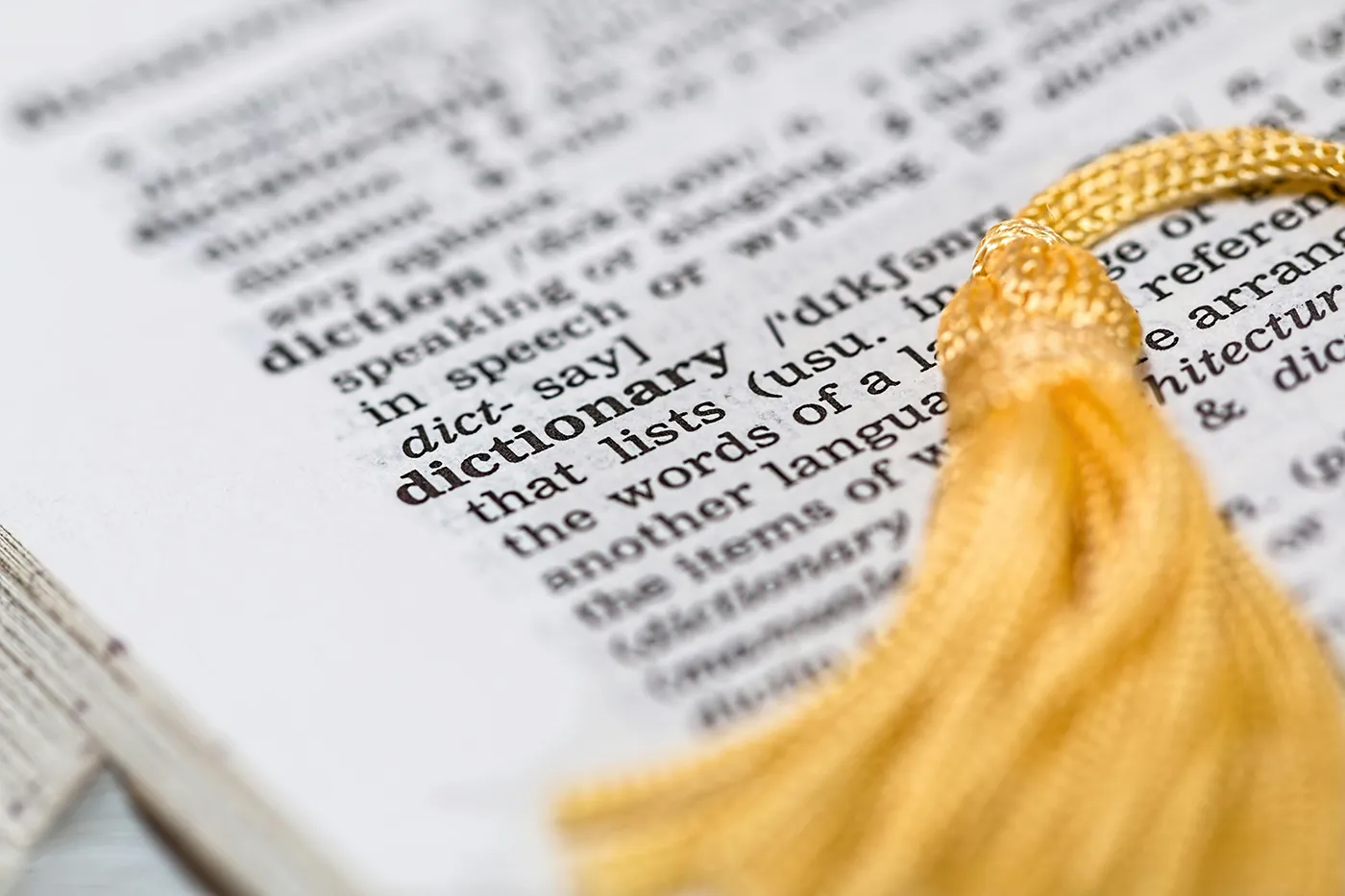Einleitung
Eine Klimabilanz – häufig auch Corporate Carbon Footprint (CCF) genannt – ist das zentrale Werkzeug, um die Treibhausgasemissionen eines Unternehmens systematisch zu erfassen und darzustellen. Sie ist weit mehr als eine reine Bestandsaufnahme: Sie bildet die Grundlage für Klimastrategien, Investitionsentscheidungen und zunehmend auch für die Erfüllung regulatorischer Pflichten.
Unternehmen, die ihre Klimabilanz kennen, können Treiber von Emissionen gezielt identifizieren, Maßnahmen priorisieren und Fortschritte transparent kommunizieren. Damit entwickelt sich die CCF zunehmend von einem freiwilligen Nachhaltigkeitsinstrument zu einem verbindlichen Bestandteil moderner Unternehmensführung.
Das Ziel ist klar: Transparenz schaffen, Reduktionspotenziale erkennen und Klimaschutzmaßnahmen wirksam steuern.
Aufbau einer Klimabilanz
Eine fundierte Klimabilanz basiert auf etablierten internationalen Standards wie dem GHG Protocol oder ISO 14064. Sie gliedert sich in drei Scopes, die zusammen den gesamten CO₂-Fußabdruck abdecken:
- Scope 1 (direkte Emissionen): entstehen unmittelbar im Unternehmen, z. B. durch den Fuhrpark, Heizungen, Notstromaggregate oder industrielle Prozesse.
- Scope 2 (indirekte Emissionen aus Energie): entstehen durch den Bezug von Strom, Wärme oder Kälte – hier wird zwischen Standort- und marktbasierten Berechnungsansätzen unterschieden.
- Scope 3 (indirekte Emissionen der Wertschöpfungskette): umfassen die gesamte Liefer- und Nutzungskette, z. B. Emissionen von Zulieferern, Geschäftsreisen oder die Nutzung verkaufter Produkte beim Kunden.
Damit bildet die Klimabilanz alle relevanten Treibhausgase (CO₂, Methan, Lachgas u. a.) in Form von CO₂-Äquivalenten (CO₂e) ab. Besonders die Einbeziehung von Scope 3 wird zunehmend gefordert, da dieser Anteil in vielen Branchen über 70 % der Gesamtemissionen ausmacht.
GHG Protocol – Scopes & Kategorien
Überblick über die Emissionsbereiche (Scope 1–3) und die zugehörigen Kategorien.
Tabelle mit drei Spalten: Scope, Titel, Beschreibung.
| Scope |
Titel |
Beschreibung |
| S1 Scope 1 |
Stationäre Verbrennung |
Direkte Emissionen aus festen Anlagen wie Heizkesseln, Öfen oder Generatoren. |
| S1 Scope 1 |
Mobile Verbrennung |
Direkte Emissionen aus firmeneigenen Fahrzeugen oder Maschinen mit Verbrennungsmotoren. |
| S1 Scope 1 |
Prozess- & flüchtige Emissionen |
Emissionen aus Prozessen (z. B. chemische Reaktionen) sowie Leckagen (z. B. Kältemittel). |
| S2 Scope 2 |
Eingekaufter Strom |
Indirekte Emissionen aus Strombezug – Standort-basiert oder Markt-basiert bilanziert. |
| S2 Scope 2 |
Eingekaufte Nah- und Fernwärme |
Emissionen aus der Bereitstellung und Nutzung von zugekaufter Wärmeenergie. |
| S2 Scope 2 |
Eingekaufte Kälte |
Emissionen aus zugekaufter Kälteversorgung (z. B. Fernkälte-Netze). |
| S3 Scope 3 |
3.1 Eingekaufte Güter & Dienstleistungen |
Vorgelagerte Emissionen aus Produktion/Anbau der eingekauften Waren und Services. |
| S3 Scope 3 |
3.2 Anlagegüter (Capital Goods) |
Herstellung von langlebigen Investitionsgütern (z. B. Maschinen, Gebäudeausstattung). |
| S3 Scope 3 |
3.3 Brennstoff- & energiebez. Aktivitäten |
Vorkettenemissionen von Brennstoffen/Energie, die nicht in Scope 1/2 fallen (WTT-Anteile, Verluste). |
| S3 Scope 3 |
3.4 Upstream-Transport & Distribution |
Transport/Distribution eingekaufter Güter zwischen Zulieferern und dem eigenen Unternehmen (inkl. Drittlogistik). |
| S3 Scope 3 |
3.5 Abfall aus Betriebstätigkeit |
Behandlung/Entsorgung von Abfällen aus dem eigenen Betrieb (ohne Produktionsnutzung beim Kunden). |
| S3 Scope 3 |
3.6 Geschäftsreisen |
Reisen von Mitarbeitenden (Flug, Bahn, PKW, Hotel – sofern nicht bereits Scope 1). |
| S3 Scope 3 |
3.7 Pendelverkehr Mitarbeitende |
Arbeitswege der Mitarbeitenden inklusive Home-Office-bedingter Verbräuche, soweit relevant. |
| S3 Scope 3 |
3.8 Upstream-verpachtete Vermögenswerte |
Emissionen aus Vermögenswerten, die das Unternehmen anmietet oder kontrolliert, aber nicht in Scope 1/2 erfasst. |
| S3 Scope 3 |
3.9 Downstream-Transport & Distribution |
Transport/Distribution verkaufter Produkte zu Händlern/Kunden (inkl. Lagerung), nach der Werksauslieferung. |
| S3 Scope 3 |
3.10 Weiterverarbeitung verkaufter Produkte |
Emissionen, die entstehen, wenn Abnehmer die Produkte weiterverarbeiten (z. B. Vorprodukte). |
| S3 Scope 3 |
3.11 Nutzung verkaufter Produkte |
Betriebsphase beim Kunden (z. B. Energieverbrauch eines Geräts, Kraftstoff von Fahrzeugen). |
| S3 Scope 3 |
3.12 End-of-Life verkaufter Produkte |
Entsorgung, Recycling oder Deponierung der verkauften Produkte nach der Nutzungsphase. |
| S3 Scope 3 |
3.13 Downstream-verpachtete Vermögenswerte |
Emissionen aus Vermögenswerten, die das Unternehmen an Dritte vermietet/verpachtet (Nutzung beim Leasingnehmer). |
| S3 Scope 3 |
3.14 Franchises |
Emissionen aus Franchise-Betrieben, die nicht anderswo erfasst sind (betriebene, aber nicht besessene Einheiten). |
| S3 Scope 3 |
3.15 Investitionen |
Anteilig zugerechnete Emissionen aus Beteiligungen, Portfolios und Finanzierungen gemäß GHG-Protokollmethodik. |
Warum ist eine Klimabilanz wichtig?
Die Relevanz einer CCF geht weit über interne Nachhaltigkeitsziele hinaus. Sie ist gleichzeitig ein Managementinstrument, ein Kommunikationswerkzeug und ein regulatorisches Pflichtinstrument.
Wichtige Gründe:
- Grundlage für Reduktionsziele: Nur wer die eigene Emissionsbasis kennt, kann realistische Reduktionsziele entwickeln und diese mit Initiativen wie der Science Based Targets initiative (SBTi) abstimmen.
- Pflicht im Rahmen der CSRD/ESRS: Die europäische Richtlinie verpflichtet immer mehr Unternehmen, ihre Klimabilanz im Nachhaltigkeitsbericht offenzulegen – und das auf auditablem Niveau.
- Relevanz für Förderungen & Labels: Förderprogramme (z. B. BAFA Modul 5) und Nachhaltigkeitslabels setzen eine belastbare Klimabilanz als Einstiegsvoraussetzung voraus.
- Kommunikation & Transparenz: Investoren, Kunden und Mitarbeitende erwarten klare Aussagen zur Klimawirkung – nicht nur für das eigene Image, sondern auch als Nachweis von Zukunftsfähigkeit.
Anwendungsfälle und Beispiele
Eine Klimabilanz ist kein Selbstzweck, sondern ein praktisches Werkzeug für unterschiedliche Organisationstypen:
- Mittelständische Unternehmen nutzen sie als Startpunkt, um Energieeffizienzmaßnahmen zu priorisieren, Investitionen in erneuerbare Energien zu rechtfertigen und Wettbewerbsvorteile zu sichern.
- Öffentliche Einrichtungen wie Museen, Hochschulen oder Kommunen erstellen Klimabilanzen, um Fördermittel zu beantragen, Reduktionspfade abzuleiten und ihre gesellschaftliche Verantwortung sichtbar zu machen.
- Großunternehmen entwickeln auf dieser Basis Transformationspläne, die sie mit internationalen Standards (z. B. SBTi, Net-Zero Frameworks) kompatibel machen und damit auch in globalen Lieferketten anerkannt werden.
Ein Praxisbeispiel: Ein produzierendes Unternehmen stellt durch die Klimabilanz fest, dass nicht die eigenen Anlagen (Scope 1), sondern eingekaufte Rohstoffe (Scope 3) den größten Emissionstreiber darstellen. Dadurch kann es gezielt auf Lieferanten einwirken und nachhaltigere Materialien bevorzugen.
Herausforderungen und Grenzen
Die Erstellung einer Klimabilanz ist methodisch anspruchsvoll. Besonders in komplexen Wertschöpfungsketten stoßen Unternehmen an Grenzen:
- Datenerhebung: Verbrauchsdaten fehlen häufig oder sind schwer zugänglich – insbesondere bei kleineren Niederlassungen oder dezentralen Prozessen.
- Scope 3-Abgrenzung: Die Lieferkette kann sehr tief und international sein. Ohne ein strukturiertes Vorgehen ist eine präzise Erfassung kaum möglich.
- Datenqualität: Unterschiedliche Berechnungsmethoden, Schätzungen und regionale Emissionsfaktoren führen schnell zu Abweichungen.
Trotz dieser Hürden gilt: Eine transparente und nachvollziehbare Klimabilanz – auch mit Annahmen und Näherungen – ist wertvoller als gar keine. Sie sollte als dynamischer Prozess verstanden werden, der mit jeder Aktualisierung robuster und präziser wird.
Praxis-Tipps für Unternehmen
Für die Umsetzung einer CCF haben sich folgende Vorgehensweisen bewährt:
- Klares Ziel setzen: Entscheiden, ob die Klimabilanz nur internen Zwecken dient oder als Grundlage für externes Reporting genutzt wird.
- Standard nutzen: Sich an etablierten Standards wie dem GHG Protocol oder ISO 14064 orientieren.
- Datenmanagement etablieren: Verbrauchsdaten (Energie, Reisen, Materialeinsätze) systematisch erfassen, aufbereiten und überprüfen.
- Regelmäßig aktualisieren: Mindestens jährlich, um Fortschritte sichtbar zu machen und Veränderungen in den Prozessen zu berücksichtigen.
- Integration in Strategie: Ergebnisse nicht isoliert betrachten, sondern aktiv in Klimaziele, Maßnahmenplanung und Nachhaltigkeitskommunikation einbinden.
Weiterführende Quellen